ChatGPT:
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Systemanalyse zur Rolle von Wasserstoff in der trilateralen Chemieregion.
Zum Inhalt (Eingabetaste) Zum Hauptmenü (Eingabetaste) Zum Untermenü und Zusatzinformationen (Eingabetaste) Zum allgemeinen Seitenmenü (Eingabetaste)
TransHyDE
Erst eine geeignete Transport-Infrastruktur gewährleistet eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft. Import, örtliche Verteilung und Speicherung verlangen nach unterschiedlichen Ansätzen. TransHyDE entwickelt Technologien für den Transport und die Speicherung von Wasserstoff weiter und testet sie. Für jeden Einsatzzweck soll am Ende die richtige Technologie gefunden werden.

Konkret betrachten die TransHyDE-Projekte den Transport von gasförmigem Wasserstoff in Pipelines und Hochdruckbehältern, den Transport von flüssigem Wasserstoff sowie den Transport von in Ammoniak oder LOHC chemisch gebundenem Wasserstoff. Außerdem prüft TransHyDE, ob und wie LNG-Terminals auf wasserstoffbasierte Energieträger umgerüstet werden könnten. Die Erkenntnisse aller TransHyDE-Projekte münden in Handlungsempfehlungen für die nationale Wasserstoff-Infrastruktur. Dazu werden unter anderem übergreifende regulatorische Rahmenbedingungen, Standards und Zertifizierungsmöglichkeiten analysiert sowie Lücken identifiziert.
Grüner Wasserstoff könnte in Zukunft gasförmig – per Pipeline oder im Hochdruckbehälter – transportiert werden. Das TransHyDE-Projekt GET H2 erforscht dafür auf einem Testfeld, wie vorhandene Erdgas-Leitungen umgestellt werden können. Gleichzeitig entwickelt das Projekt geeignete Materialien für neue Wasserstoff-Pipelines. Als Zwischenspeicher und dezentrale Transportmöglichkeit könnten sich Hochdruckspeicher eignen. Zum Beispiel Kugelspeicher, wie sie das TransHyDE-Projekt Mukran entwickeln möchte.
Damit Pipelines sicher verwendet und Lecks frühzeitig erkannt werden können, arbeitet das TransHyDE-Projekt Sichere Infrastruktur an Methoden der Gas-Sensorik. Mit einem Hochdruckprüfstand und einem Pipeline-Testnetz prüft es die gewonnenen Erkenntnisse unter Praxis-Bedingungen.
Das Projekt betrachtet die gesamte Transportkette für gasförmigen Wasserstoff per Pipeline: angefangen bei der Einspeisung, inklusive Verdichteranlage, bis hin zur Ausspeisung an nachgelagerte Netze, Wasserstoff-Tankstellen oder industrielle Verbrauchsanlagen. Dabei stehen ehemalige Erdgasleitungen und ihre Wasserstofftauglichkeit im Mittelpunkt des TransHyDE-Projekts GET H2. Neben Verfahren zur Qualitäts- oder Mengenbestimmung geht es in dem Projekt am Kraftwerkstandort Lingen um Methoden zur regelmäßigen Überprüfung der Leitungen. Dafür sollen Verfahren zur Reinigung und Inspektion der Wasserstoff-Leitungen entwickelt werden sowie ein Ferndetektionssystem für Wasserstofflecks.
Langtitel: GET H2 TransHyDE – Infrastrukturelle und betriebstechnische Aspekte bei der Umstellung von Erdgastransportleitungen auf Wasserstoffbetrieb und beim Neubau von Wasserstoffnetzen
Förderkennzeichen: 03HY207A-J
Gesamtfördersumme: 11,62 Mio. €
Partner: 10
Projektlaufzeit: 01.04.2021–31.12.2025
Kontakt in das Projekt:
Dr. Frank Graf und Sonja Rothenbacher
Koordination des Projekts
DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des KIT
graf@dvgw-ebi.de und rothenbacher@dvgw-ebi.de
Das TransHyDE-Projekt Mukran demonstriert die gesamte Prozesskette für die Entwicklung und den Transport von Hochdruckbehältern. Dafür erarbeitet das Projekt zwei innovative Kugelspeicher: in einer Variante aus verschiedenen Stahllegierungen und in einer Variante mit einem Innenleben aus Stahl und einer lasttragenden Außenhülle aus karbonfaserverstärktem Kunststoff. Durch die Kugelform soll – im Vergleich zur herkömmlichen Zylinderform – die Außenhülle weniger belastet werden. Exemplarisch demonstrieren die Forschenden den Transport der beiden Prototypen mittels LKW. In Zukunft könnten die Hochdruckbehälter auch per Schiff oder Zug transportiert werden. Welche Möglichkeit für welchen Einsatzzweck am sinnvollsten ist, soll ebenfalls im Projekt erarbeitet werden.
Langtitel: Erforschung innovativer Speicher- und Transportlösungen [Mukran]
Förderkennzeichen: 03HY206A-I
Gesamtfördersumme: 19,34 Mio. Euro
Partner: 6
Projektlaufzeit: 04/2021–10/2026
Kontakt in das Projekt:
Janina Senner
Koordination des Projekts
Gas- und Wärme-Institut Essen e. V.
janina.senner@gwi-essen.de
Für die Etablierung einer sicheren und dauerhaften Wasserstoff-Infrastruktur müssen Leitungen, Speicher und Anschlussstellen langfristig für Wasserstoff geeignet sein. Das TransHyDE-Projekt Sichere Infrastruktur bewertet daher verschiedene Materialien bezüglich ihrer Sicherheit und Lebensdauer. Zudem entwickelt es Sensoren und Systeme, um mögliche Gasaustritte oder Spurengase im Wasserstoff zuverlässig zu erkennen. Um die sichere Verteilung von Wasserstoff in der Praxis zu testen, stellen die Projektpartner außerdem ein Erdgas-Verteilnetz in Bayern auf Wasserstoff um. Aus den Ergebnissen des Projekts sollen ein Leitfaden und eine Roadmap zur Umstellung der Infrastruktur entstehen.
Langtitel: Verbundvorhaben TransHyDE_FP2: Sichere Infrastruktur
Förderkennzeichen: 03HY202A-G
Gesamtfördersumme: ca. 11,96 Mio. €
Partner: 8
Projektlaufzeit: 04/2021–12/2025
Kontakt in das Projekt:
Thomas Plocher
Koordination des Projekts
RMA Rheinau GmgH & Co. KG
+49 (0) 7844-404-0
thomas.plocher@rma.de
Ein Liter flüssiger Wasserstoff (bei –252,9 °C) enthält etwa 800-mal mehr Energie als ein Liter gasförmiger Wasserstoff (bei Raumtemperatur). Deshalb wird bereits heute Wasserstoff zum Transport und zur Speicherung verflüssigt – zum Beispiel für Wasserstoff-Tankstellen. In einem zukünftigen Wasserstoffnetz eignen sich große Flüssigwasserstoff-Speicher daher auch zum Ausgleich von Bedarfsschwankungen. Die Verflüssigung von Wasserstoff und die Speicherung von Flüssigwasserstoff sind etablierter Stand der Technik. Dennoch besteht weiterer Forschungsbedarf, zum Beispiel zur Effizienzsteigerung, zur Skalierung der Anlagen und zu positiven Wechselwirkungen mit dem weiteren Energiesystem. Hier setzt das TransHyDE-Projekt AppLHy! an. Es untersucht unter anderem, wie man die Kälte des Flüssigwasserstoffs für die Industrie oder zur effizienten Stromleitung nutzen könnte.
Das TransHyDE-Projekt AppLHy! nimmt den Transport, die Speicherung und die Anwendung von flüssigem Wasserstoff (LH2) ganzheitlich in den Blick. Dazu gehören unter anderem die Demonstration einer effektiven LH2-Pumpe und eines verlustarmen Speichers sowie die Ermittlung von künftigen Bedarfen und Einsatzmöglichkeiten für flüssigen Wasserstoff. Des Weiteren beschäftigen sich die Projektpartner mit Wechselwirkungen, die der Transport von flüssigem Wasserstoff mit sich bringt. Dazu demonstrieren und bewerten sie den kombinierten Transport von Flüssigwasserstoff und elektrischer Energie in Hochtemperatur-Supraleitern sowie die Kältenachnutzung in bestehenden Kältetechnik-Systemen.
Langtitel: Verbundvorhaben TransHyDE_FP4: Transport und Anwendung von flüssigem Wasserstoff
Förderkennzeichen: 03HY204A-H
Gesamtfördersumme: ca. 15,2 Mio. €
Partner: 8
Projektlaufzeit: 04/2021–12/2025
Kontakt in das Projekt:
Prof. Dr. Tabea Arndt
Koordination des Projekts
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Technische Physik (ITEP)
+49 (0) 721 6082 3501
applhy@itep.kit.edu
Eine weitere Möglichkeit des Wasserstoff-Transports, der vor allem über große Entfernungen favorisiert wird, ist seine Bindung an andere Moleküle. So entstehen Verbindungen, die sich einfacher transportieren lassen. Zur Nutzung des Wasserstoffs muss dieser für die meisten Anwendungen nach dem Transport jedoch wieder aus den Verbindungen gelöst werden. In TransHyDE werden zwei Möglichkeiten dieser Art des Wasserstoff-Transports näher beleuchtet: Ammoniak und LOHC.
Ammoniak ist eine Stickstoff-Wasserstoff-Verbindung, die in großen Mengen in der Landwirtschaft und Industrie eingesetzt wird. Im Umgang mit dieser Chemikalie gibt es somit bereits einen großen Erfahrungsschatz. In TransHyDE beschäftigen sich zwei Projekte mit Fragestellungen zur Nutzung von Ammoniak als Energieträger. Offene Fragen, an denen das TransHyDE-Projekt AmmoRef arbeitet, beziehen sich vor allem auf die effiziente und kostengünstige Herauslösung des Wasserstoffs aus Ammoniak. Passend dazu möchte das TransHyDE-Projekt CAMPFIRE die gesamte Transportkette mit Grünem Ammoniak demonstrieren. Dabei geht es unter anderem um die Schiff-zu-Schiff-Betankung.
Wasserstoff kann im Hoch- oder Niederdruck-Verfahren aus Ammoniak zurückgewonnen werden. Das TransHyDE-Projekt AmmoRef möchte beide Wege der Reformierung optimieren und industriell umsetzbar machen. Im Technikumsmaßstab testen die Projektpartner ein angepasstes Management für die beiden Prozesse. Dabei sollen auch neue Katalysatoren zum Einsatz kommen, die die Projektpartner entwickeln. Sie sollen hochaktiv arbeiten und für stabile Prozessabläufe sorgen. Zur Kostensenkung und Schonung der Umwelt soll ihr Edelmetallanteil möglichst reduziert werden. Die entwickelten Katalysatoren werden an das TransHyDE-Projekt CAMPFIRE weitergegeben, wo sie im größeren Maßstab getestet werden.
Langtitel: Verbundvorhaben TransHyDE_FP3: Reformierung von Ammoniak – Transport von H2 über Derivate
Förderkennzeichen: 03HY203A-F
Gesamtfördersumme: ca. 14,7 Mio. €
Partner: 7
Projektlaufzeit: 04/2021–12/2025
Kontakt in das Projekt:
Dr. rer. nat. Michael Poschmann
Koordination des Projekts
MPI für Chemische Energiekonversion
michael.poschmann@cec.mpg.de
In Poppendorf bei Rostock demonstriert das TransHyDE-Projekt CAMPFIRE die gesamte Transportkette für Wasserstoff auf der Basis von Grünem Ammoniak. Dabei werden Technologien für den Schiffstransport von flüssigem Ammoniak (tiefkalt oder druckverflüssigt) und die Schiffsbetankung mit Ammoniak entwickelt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Anwendung von Ammoniak-Wasserstoff-Gemischen in Motoren für die schiff- und landseitige Energieversorgung. Für ein kurzzeitiges Überangebot an Erneuerbarer Energie arbeitet das Projekt an Katalysatoren und Reaktoren für eine flexible Ammoniak-Erzeugung. Ammoniak könnte damit als Speicher für überschüssige Energie eingesetzt werden.
Langtitel: Umsetzungsprojekt CAMPFIRE – Ammoniak als Transportlösung für Grünen Wasserstoff
Förderkennzeichen: 03HY209A-Z
Gesamtfördersumme: 31,1 Mio. €
Partner: 19
Projektlaufzeit: 01.04.2021–31.12.2025
Kontakt in das Projekt:
Dr. Angela Kruth
Koordination des Projekts
Leibniz Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) e. V.
+49 (0) 3834 554 3860
angela.kruth@inp-greifswald.de
LOHC ist eine organische Trägerflüssigkeit, die Wasserstoff chemisch an sich binden und wieder freisetzen kann, Hydrierung und Dehydrierung genannt. Sie ist eine weitere große Hoffnung für den Wasserstoff-Transport über lange Strecken. Das TransHyDE-Projekt Helgoland erforscht deshalb die gesamte Transportkette: von der Bindung von Wasserstoff an LOHC bis zur Trennung.
Das TransHyDE-Projekt Helgoland erforscht und entwickelt modellhaft eine Transportkette auf Basis des LOHCs Benzyltoluol zwischen Helgoland und dem Hafen Hamburg. Darin wird die deutsche Insel als Ort der Wasserstoff-Einspeicherung (Hydrierung) sowie der Zielhafen Hamburg als Ort der Wasserstoff-Freisetzung (Dehydrierung) betrachtet. Die Forschenden untersuchen dabei auch, wie die Abwärme aus dem Hydrierprozess zur Wärmeversorgung der Insel genutzt werden könnte. Material- und Sicherheitsaspekte beim Transport sowie Fragen der Klassifizierung und Normung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Arbeit der Partner. Das Ziel ist eine Blaupause, die an vergleichbaren Standorten weltweit den Aufbau einer LOHC-basierten Wasserstoff-Transportkette ermöglicht.
Langtitel: Umsetzungsvorhaben Helgoland
Förderkennzeichen: 03HY208 A-J
Gesamtfördersumme: 13,7 Mio. €
Partner: 9
Projektlaufzeit: 04/2021–12/2025
Kontakt in das Projekt:
Christoph Tewis
Koordination des Projekts
Tewis Projektmanagement GmbH
+49 (0) 40 6963267-50
info@te-pm.de
Viele der Technologien zum Wasserstoff-Transport sind bislang noch nicht ausgereift und werden zurzeit experimentell oder kleinskalig umgesetzt. Unklar ist außerdem auch, ob Import-Infrastrukturen, wie die geplanten LNG-Terminals, in Zukunft für wasserstoffbasierte Energieträger genutzt werden können. Feststeht jedoch, dass für jede Form der Speicherung und des Transports von Wasserstoff, Ammoniak, LOHC und weiteren wasserstoffbasierten Energieträgern geeignete Rahmenbedingungen benötigt werden. TransHyDE analysiert daher den systemischen Rahmen und identifiziert Gestaltungsbedarfe. Die Ergebnisse aller TransHyDE-Projekte münden in Handlungsempfehlungen. Sie enthalten unter anderem Anpassungsbedarfe zu Standards, Normen und Zertifizierungsoptionen von Wasserstoff-Speicher- und -Transport-Technologien.
Die in Deutschland entstehenden LNG-Terminals sind auf die Anlandung von Erdgas aus verschiedenen Importländern ausgerichtet. Das TransHyDE-Projekt LNG2Hydrogen befasst sich mit einer möglichen Umstellung der Terminals auf wasserstoffbasierte Energieträger. Dazu zählen zum Beispiel Ammoniak, LOHC oder auch SNG. Dabei werden die aktuellen Gegebenheiten analysiert und notwendige technische sowie rechtliche Anpassungen dargelegt. Zusätzlich beschäftigt sich das Projekt mit den Kriterien und Planungsmaßnahmen für neue Terminalinfrastrukturen. Zudem nehmen die Partner den innerdeutschen Weitertransport in den Blick und analysieren technische und logistische Herausforderungen. Abschließend werden die einzelnen Optionen bewertet und wirtschaftlich eingeordnet.
Langtitel: TransHyDE – LNG-Terminals
Förderkennzeichen: 03HY210 A-P
Gesamtfördersumme: ca. 3,6 Mio. €
Partner: 16
Projektlaufzeit: 06/2023–12/2024
Kontakt in das Projekt:
Kai Ruske
Koordination des Projekts
cruh21 GmbH
ruske@cruh21.com
Das TransHyDE-Projekt Norm will Regelungslücken bezüglich der geltenden Normen, Standards und technischen Zertifizierungsprogramme aufzeigen und Lösungsansätze entwickeln. Die Projektpartner arbeiten dabei eng mit den anderen TransHyDE-Projekten zusammen. So wird gewährleistet, dass auch Ansprüche der neu entwickelten Technologien an den normativen Rahmen berücksichtigt werden.
Langtitel: Verbundvorhaben TransHyDE_FP5: Standardisierung, Normung und Zertifizierung
Förderkennzeichen: 03HY205A-I
Gesamtfördersumme: ca. 2,5 Mio. €
Partner: 10
Projektlaufzeit: 04/2021–12/2025
Kontakt in das Projekt:
Thomas Systermans
Koordination des Projekts
DVGW e. V.
+49 228 9188 904
thomas.systermans@dvgw.de
Im TransHyDE-Projekt Systemanalyse wird der Transport des Wasserstoffs im Kontext des gesamten Energie- und Wirtschaftssystems betrachtet. Die Projektpartner modellieren dafür, wie sich Nachfrage, Bedarf und Transport-Infrastruktur von Grünem Wasserstoff räumlich und zeitlich entwickeln könnten. Dabei werden die im Leitprojekt erarbeiteten und optimierten Transportoptionen mit einbezogen. Die Erkenntnisse werden in einer digitalen Roadmap gebündelt, die kontinuierlich angepasst wird. Hier gelangen Sie zur Roadmap.
Langtitel: Verbundvorhaben TransHyDE_FP1: Systemanalyse zu Transportlösungen für grünen Wasserstoff
Förderkennzeichen: 03HY201A-V
Gesamtfördersumme: ca. 17,5 Mio. €
Partner: 22
Projektlaufzeit: 04/2021-12/2025
Kontakt in das Projekt:
Dr. Florian Ausfelder und Prof. Mario Ragwitz
Koordination des Projekts
DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. und Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG
florian.ausfelder@dechema.de und mario.ragwitz@ieg.fraunhofer.de
Da für jede Speicher- und Transportoption Rahmenbedingungen benötigt werden, beschäftigen sich auch weitere TransHyDE-Projekte mit den notwendigen Bedingungen für die jeweils betrachtete Option.
Die zehn TransHyDE-Projekte bearbeiten unterschiedliche Fragestellungen und sind in ihren Arbeiten eigenständig. Dennoch profitieren sie von dem engen Austausch untereinander. Damit dieser koordiniert und sichergestellt wird, gibt es das TransHyDE-Projekt Kommunikation und Koordination. Hier laufen die Fäden der Plattform zusammen. Das Projekt koordiniert die interne und externe Kommunikation, seine Koordinatoren repräsentieren TransHyDE außerdem nach außen.
Karte der TransHyDE-Partner
Tabelle der TransHyDE-Partner
Die Daten zeigen die ausführenden Stellen der TransHyDE-Partner (Stand: 01.08.2023).
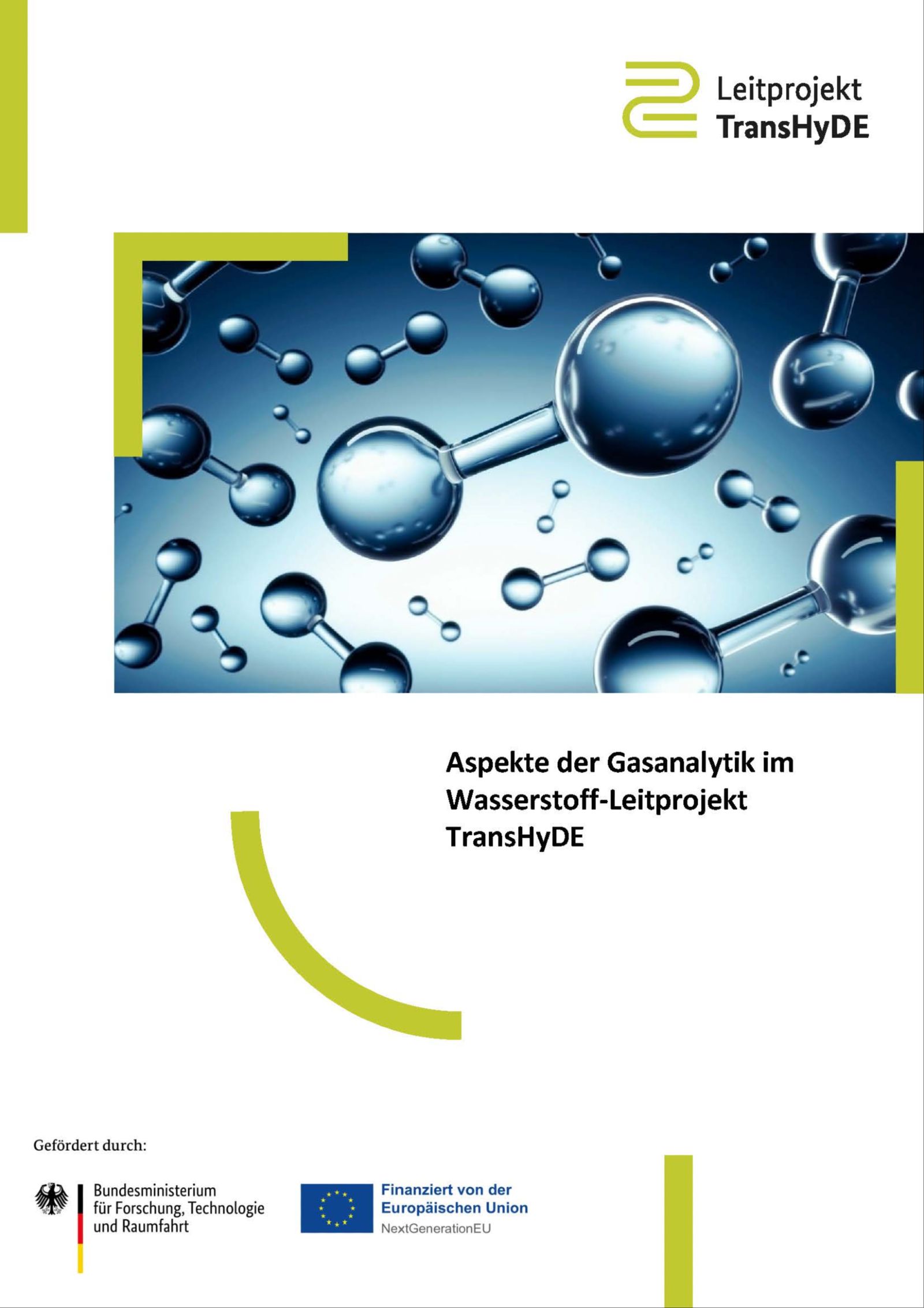
Begleitpapier Grundstoff-Industrie
Begleitendes TransHyDE-Whitepaper zu Transformationspfaden der Grundstoffindustrien.
Zum Papier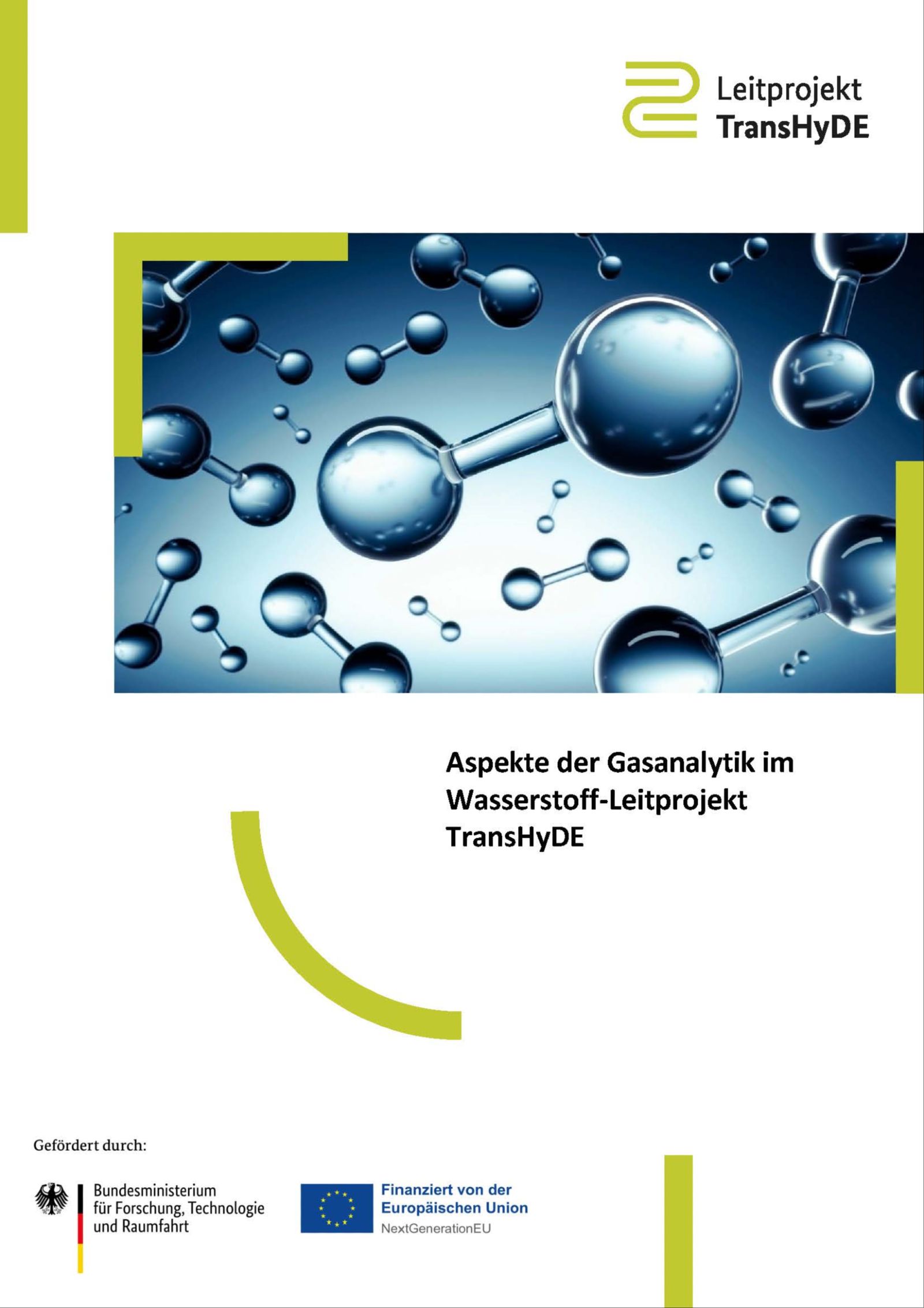
Grundstoff-Industrie
Whitepaper im Kontext des Arbeitspakets Infrastrukturentwicklung zu Transformationspfaden der Grundstoffindustrien.
Zum Papier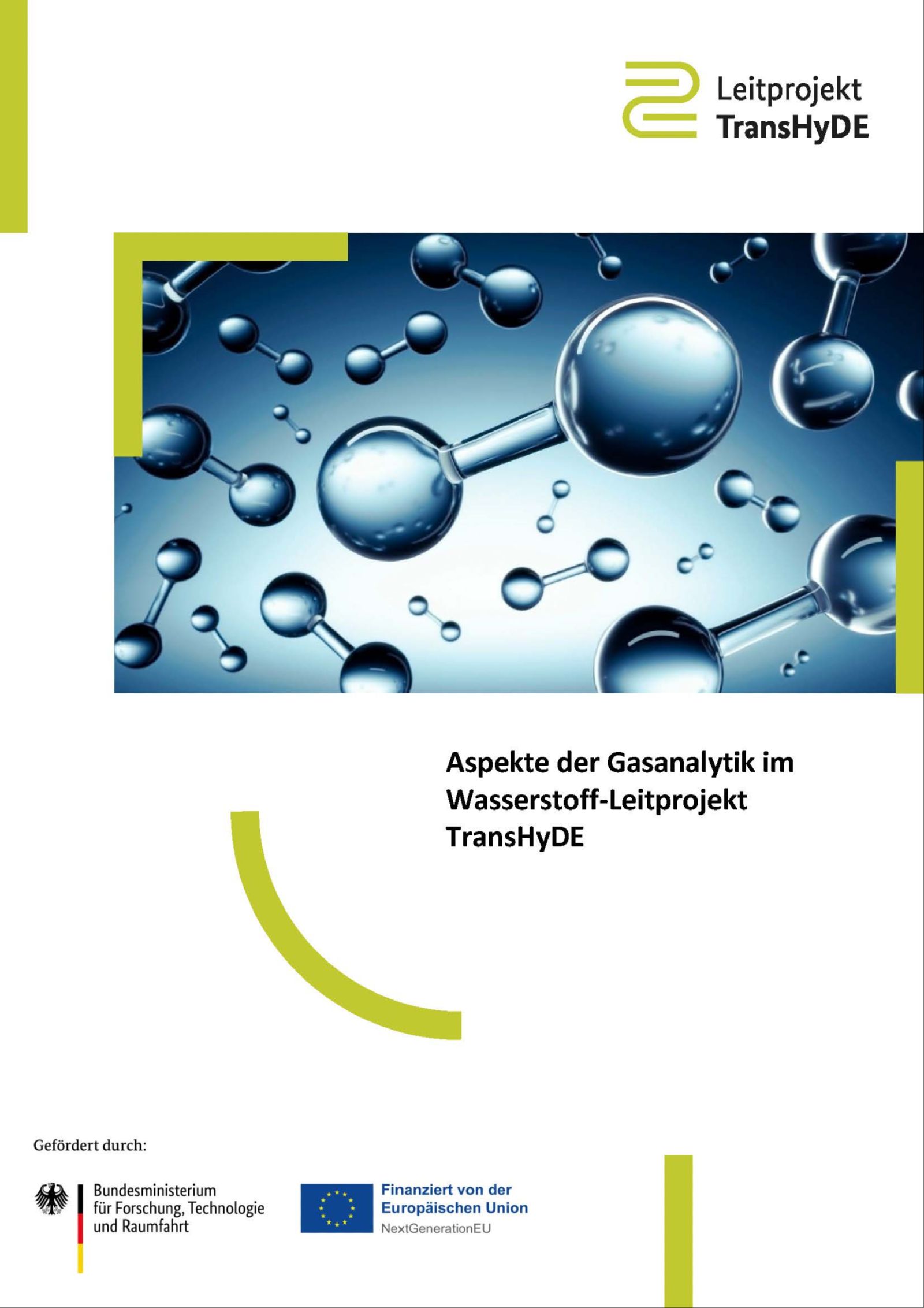
Zementindustrie
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Systemanalyse zu Zukunftspfaden für die emissionsarme Transformation der Zementindustrie.
Zum Papier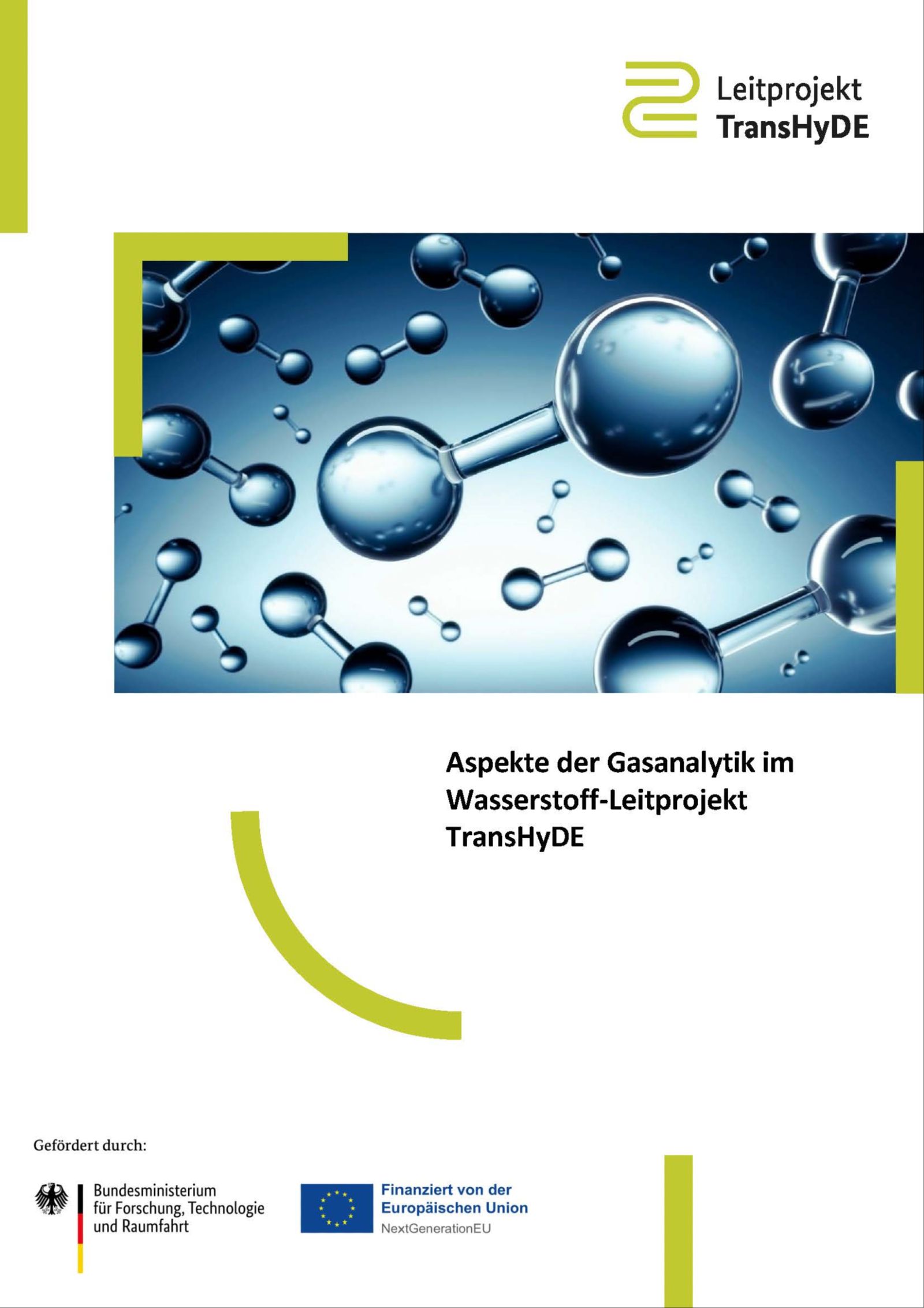
TransHyDE Roadmap
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Systemanalyse: multiperspektivische Roadmap zu Aspekten der Wasserstoff-Infrastruktur.
Zum Papier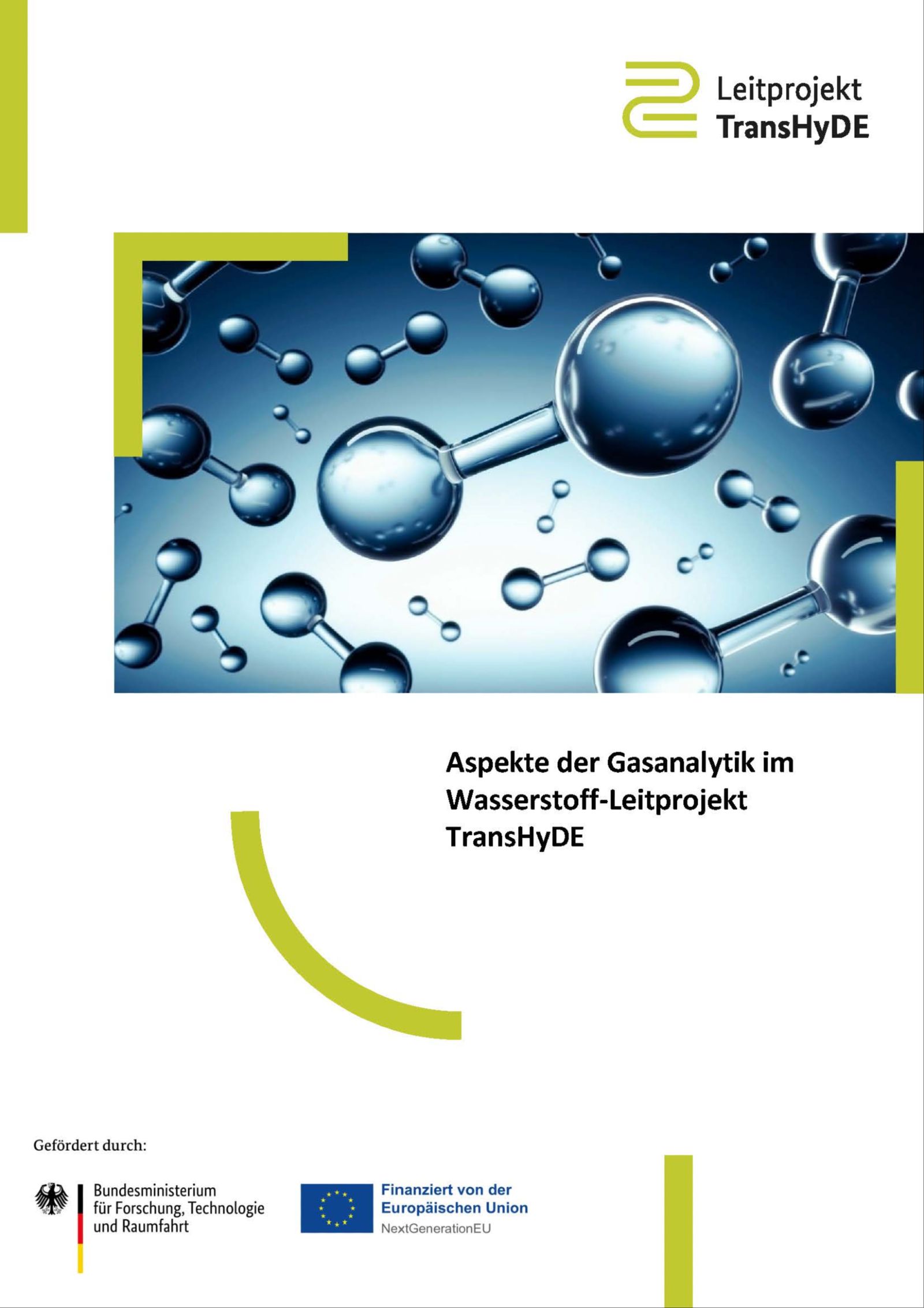
Wasserstoff-Infrastruktur
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Systemanalyse zu Zukunftspaden der europäischen Wasserstoff-Infrastruktur (englischer Text mit deutscher Zusammenfassung).
Zum Papier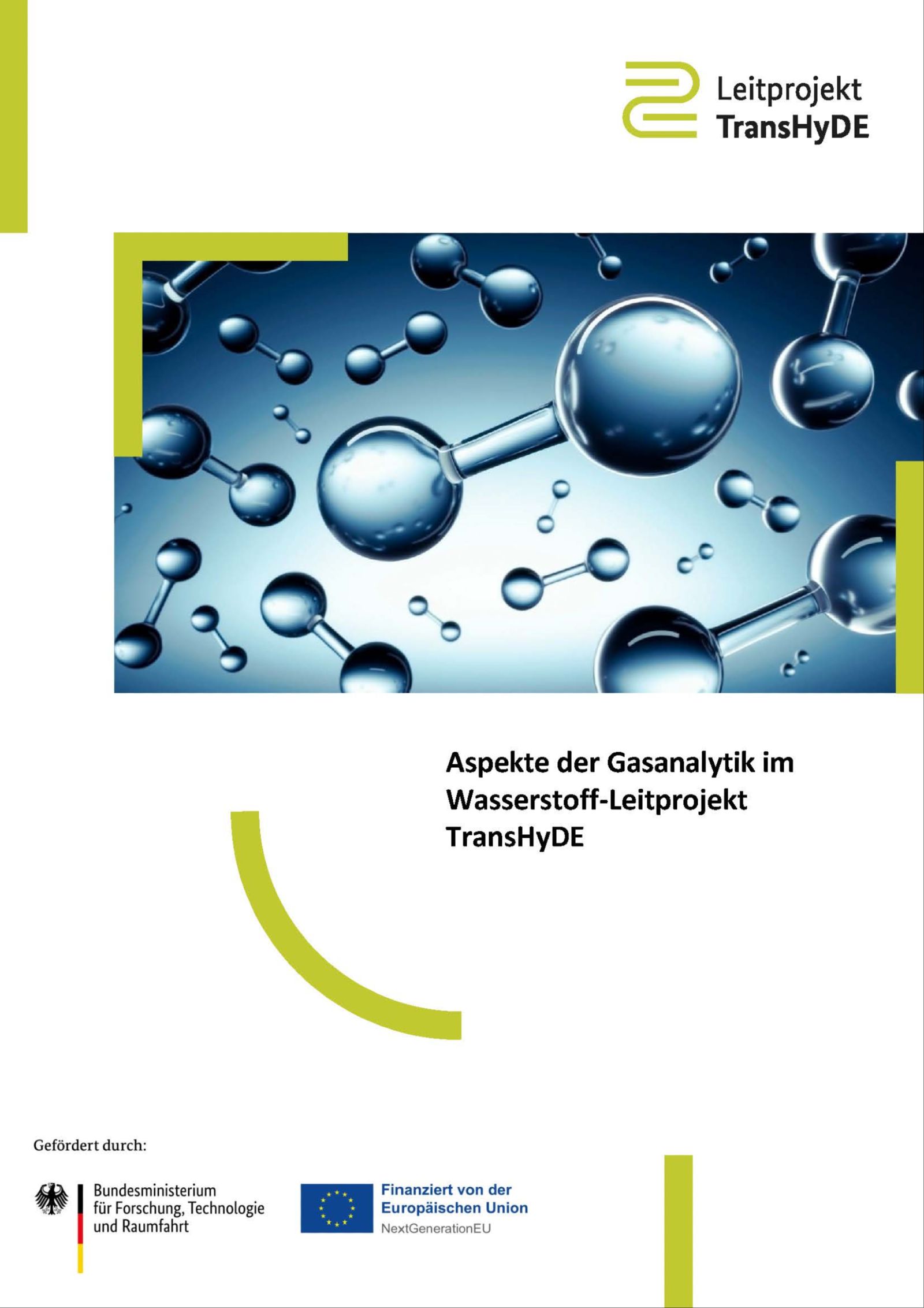
Pipeline-Infrastruktur
Whitepaper zur Analyse des pipelinegebundenen Transports von flüssigen Energieträgern und chemischen Rohstoffen.
Zum Papier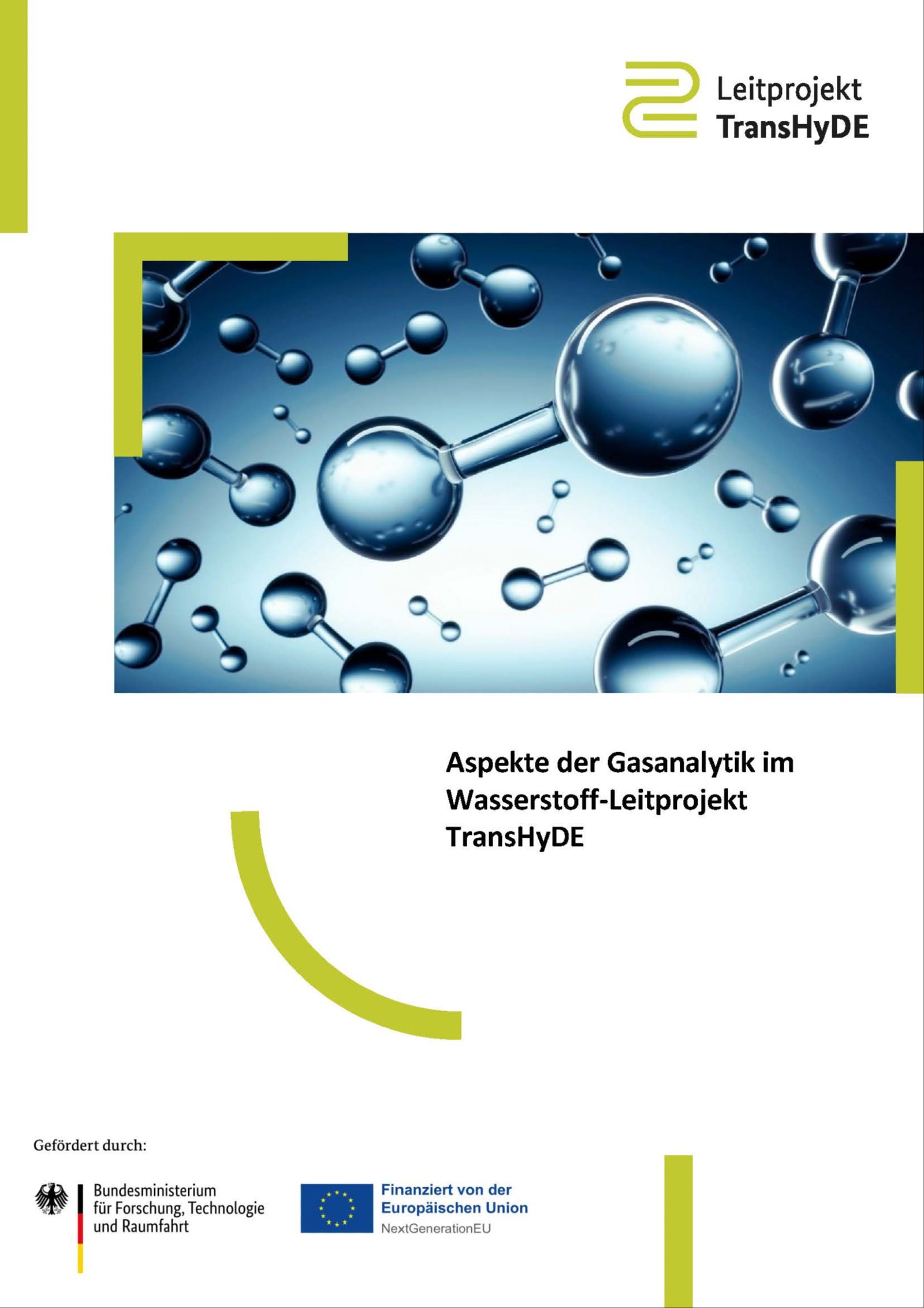
Binnenschifffahrt als Baustein der Wasserstoffwirtschaft
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Systemanalyse zur zukünftigen Rolle der Binnenschifffahrt in der Wasserstoffwirtschaft.
Zum Papier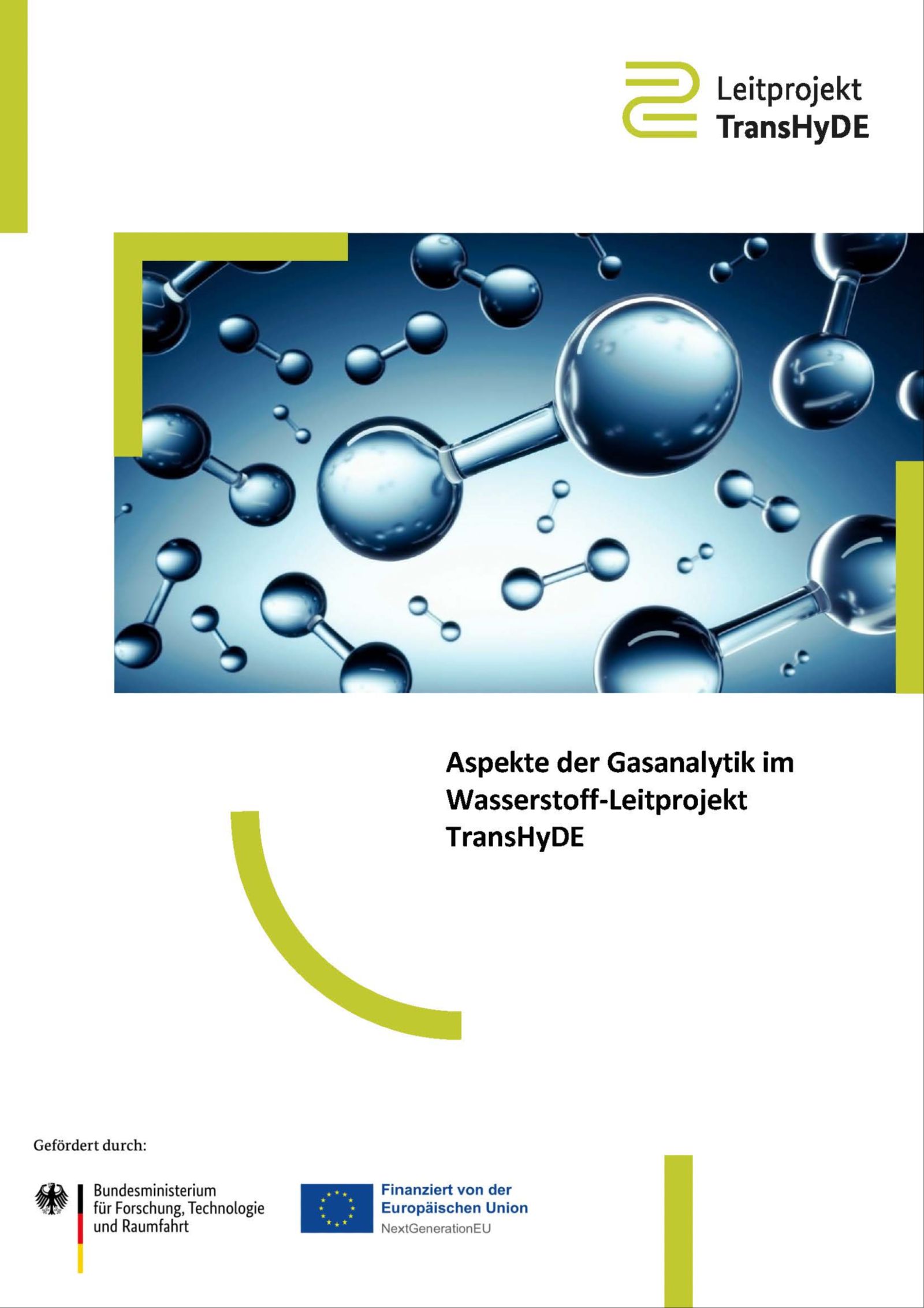
Aspekte der Gasanalytik von Wasserstoff
Whitepaper zur Bestimmung der Gaszusammensetzung und -qualität im Kontext einer gelingenden Wasserstoffwirtschaft.
Zum Papier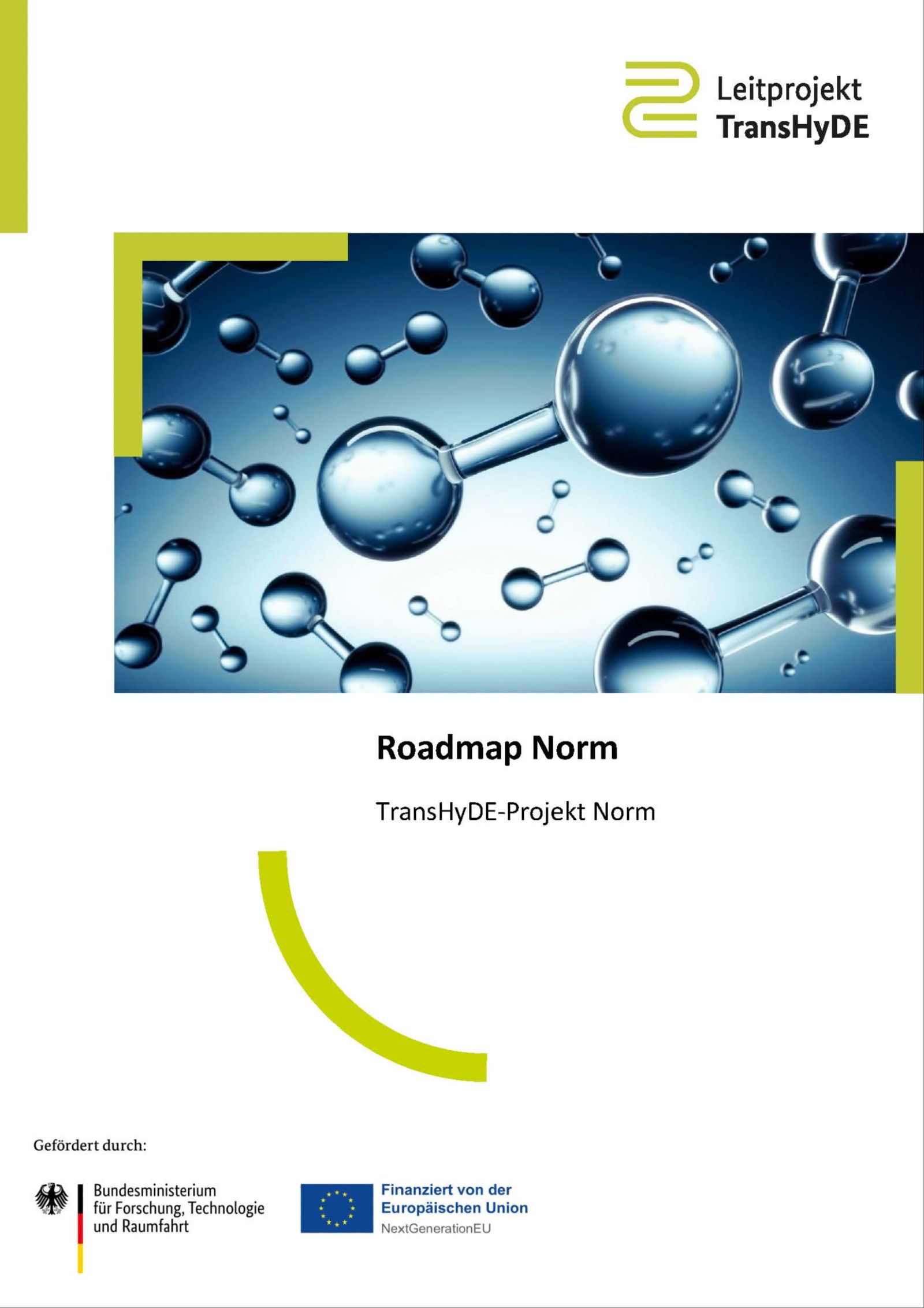
Rahmenbedingungen der Wasserstoff-Infrastruktur
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Norm mit einer ausführlichen Roadmap zu aktuellen Regelsetzungsbedarfen und Zukunftspotentialen bestehender Strukturen.
Zum Papier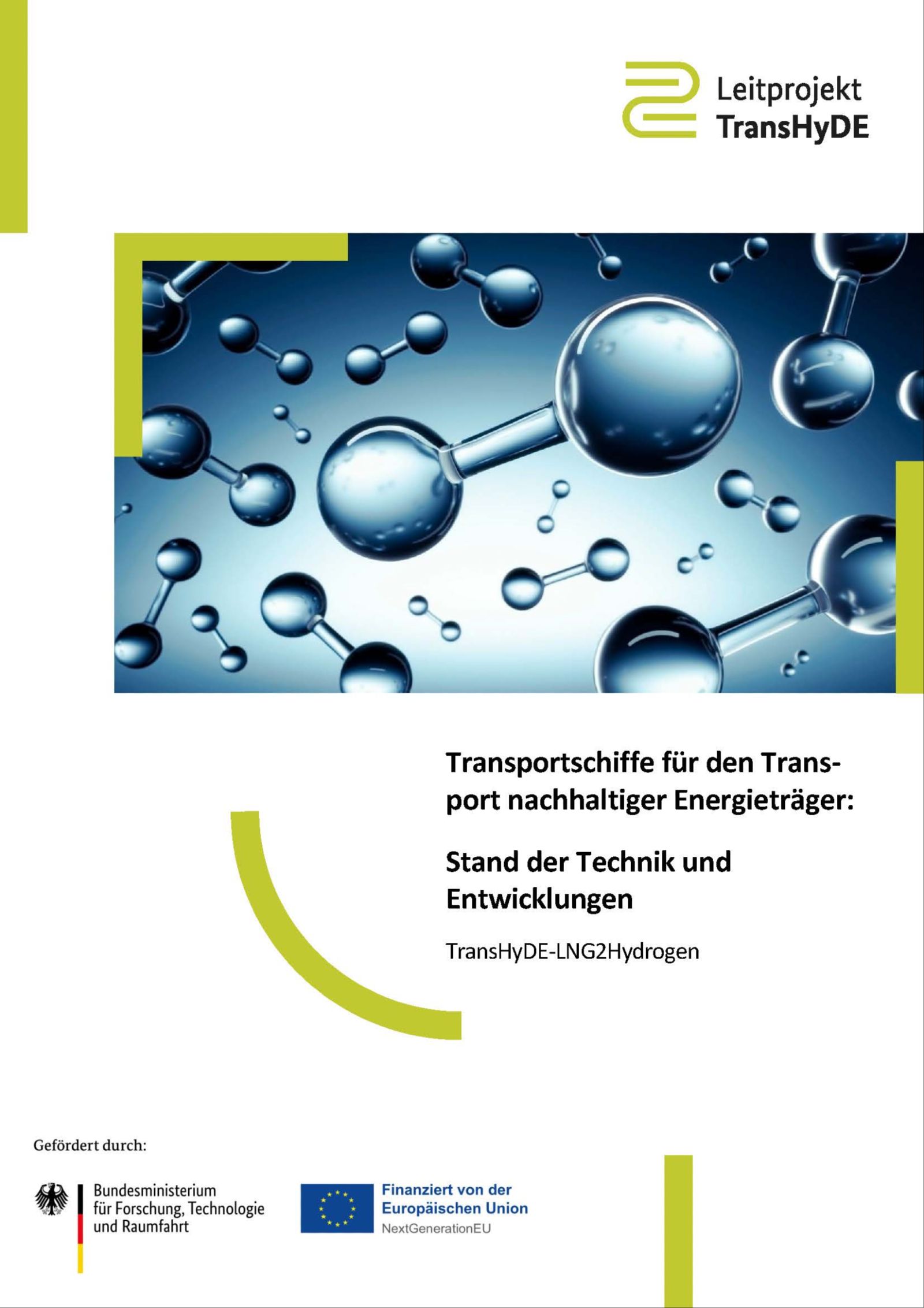
Wasserstoff-Import per Transportschiff
Whitepaper des TransHyDE-Verbunds LNG2Hydrogen zum aktuellen Stand der Technik des Wasserstoff-Imports per Transportschiff.
Zum Papier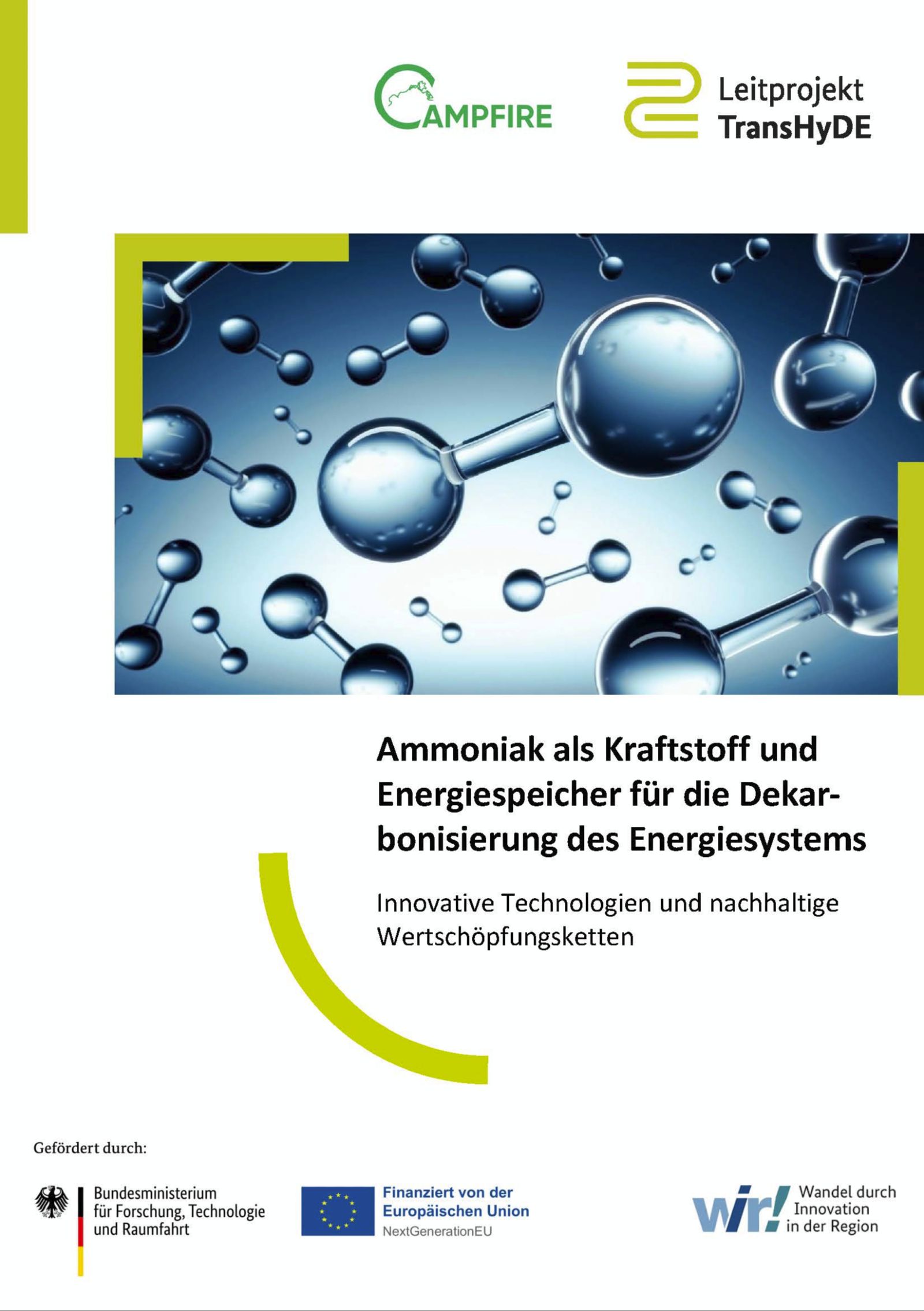
Transport-, Speicher- und Einsatzmöglichkeiten von Ammoniak
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Campfire zu Ammoniak als Kraftstoff und Energiespeicher für die Dekarbonisierung des Energiesystems.
Zum Papier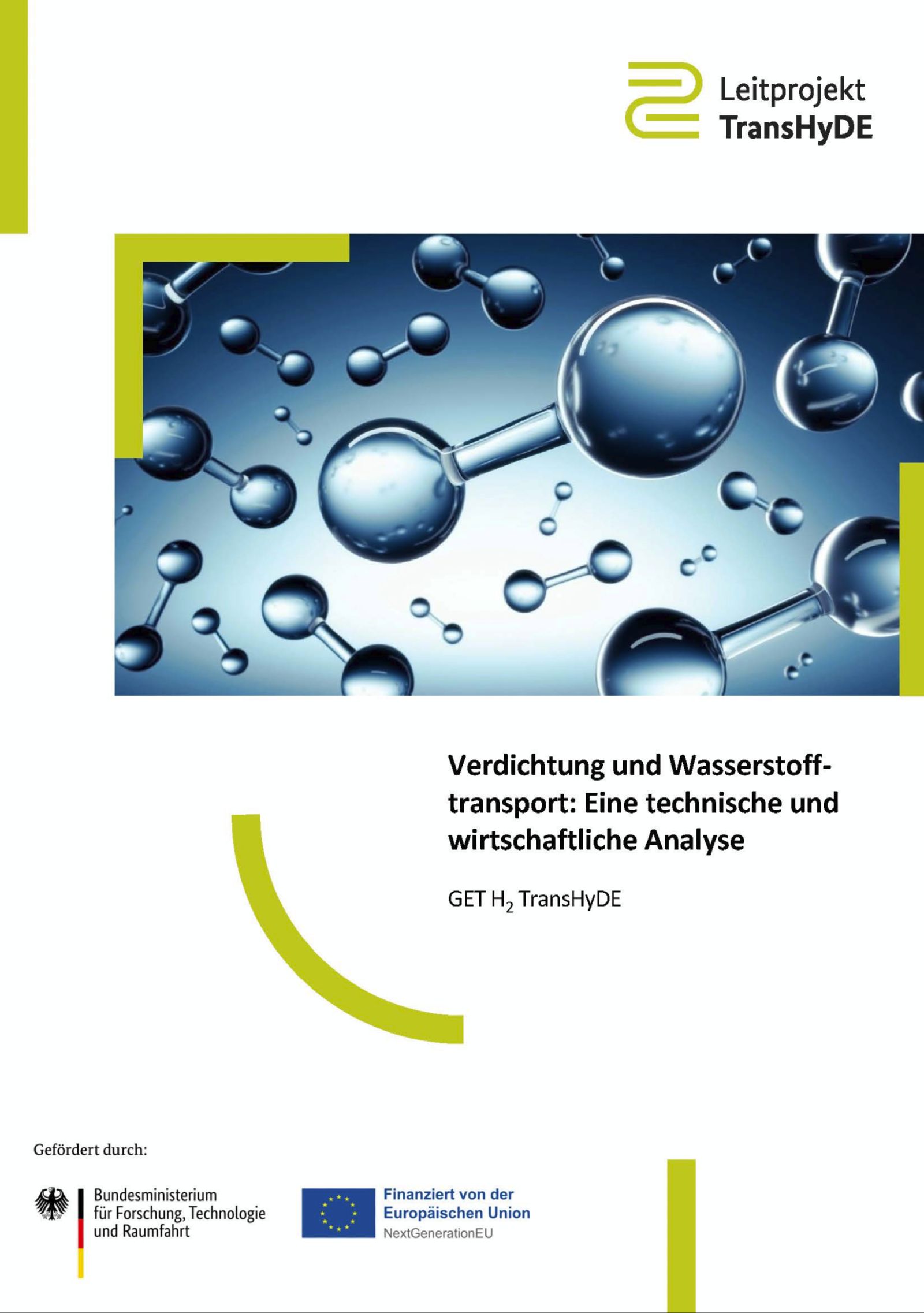
Verdichtung und Transport
Whitepaper des TransHyDE-Projekts GET H2 zu Verdichtung und Transport von Wasserstoff hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Aspekte.
Zum Papier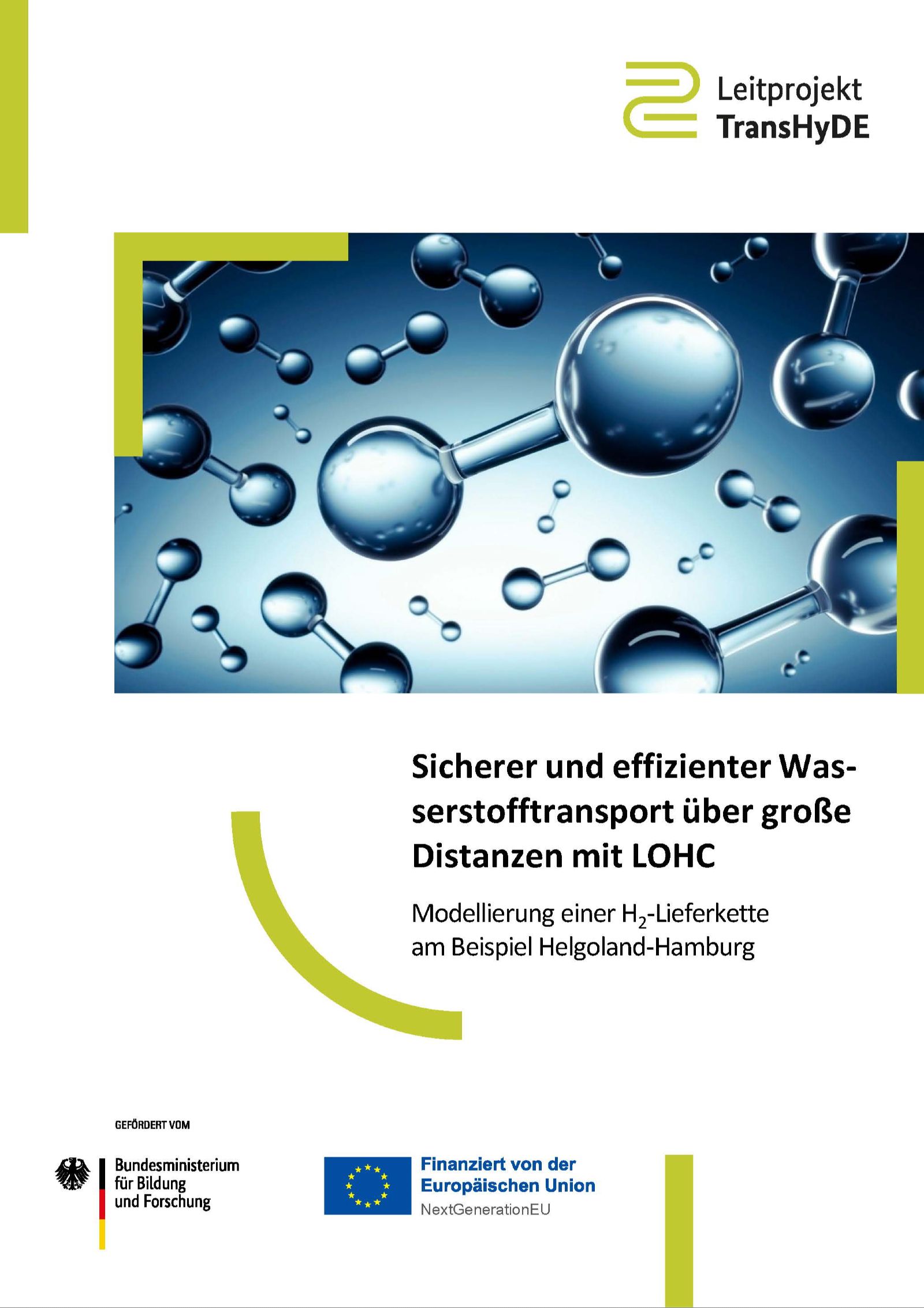
Transportinfrastrukturen
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Helgoland zum Wasserstofftransport über große Distanzen mit LOHC durch Modellierung einer H2-Lieferkette
Zum Papier
Wasserstoff-Infrastruktur
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Systemanalyse zur Transformation des Ener-
giesystems und der Wasserstoff-Infrastrukturplanung in Europa (englischer Text mit deutscher Zusammenfassung)
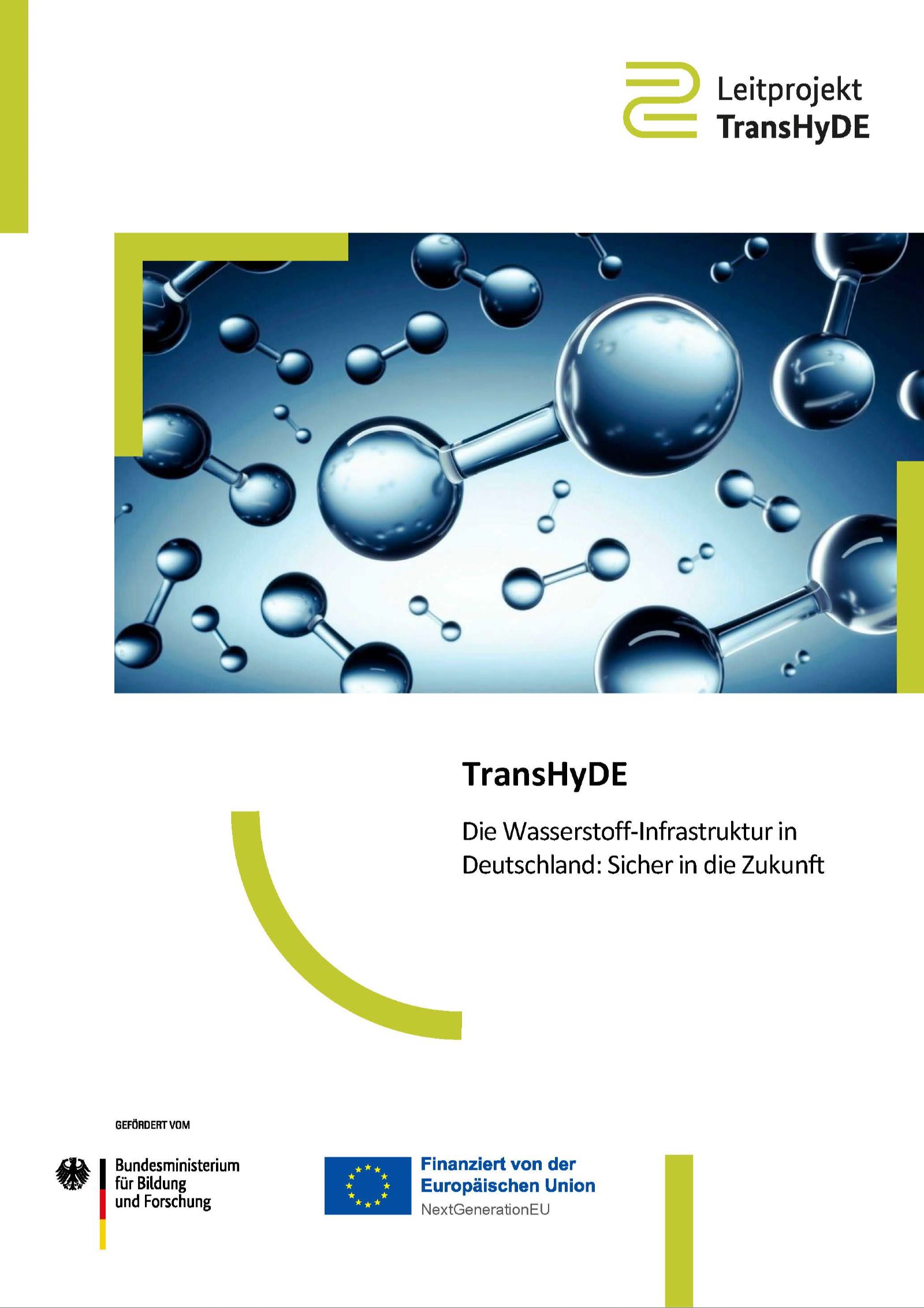
Wasserstoff-Infrastruktur
Whitepaper zu sicherheitstechnischen Aspekten der Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland
Zum Papier
Transport- und speicheroptionen
Whitepaper des TransHyDE-Projekts Norm zur Normierung und Regelung der in TransHyDE untersuchten Wasserstofftransport- und Speicheroptionen
Zum Papier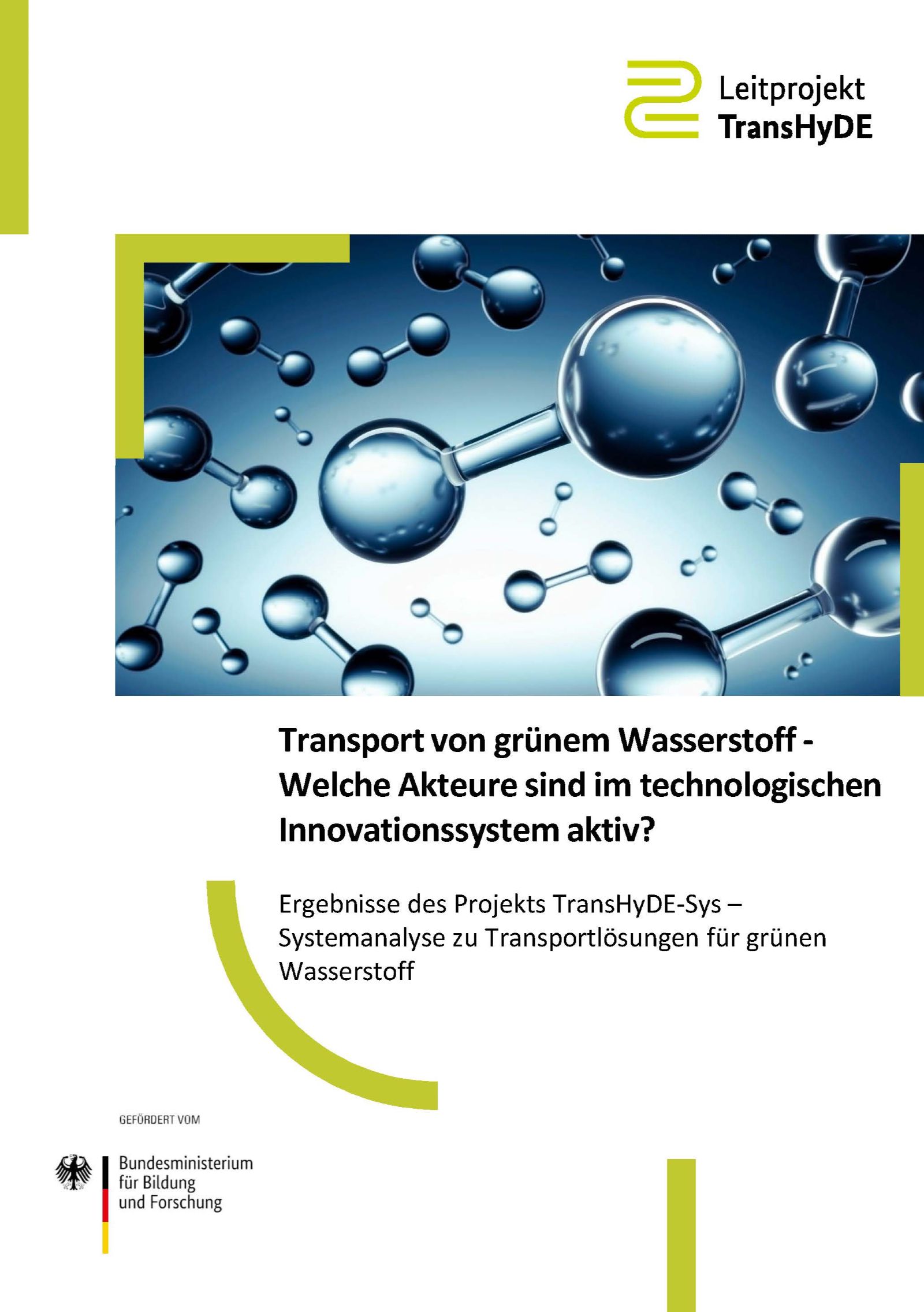
Analyse von Transport-Akteuren
Whitepaper zu Ergebnissen des Projekts TransHyDE-Sys – Systemanalyse zu Transportlösungen für Grünen Wasserstoff
Zum Papier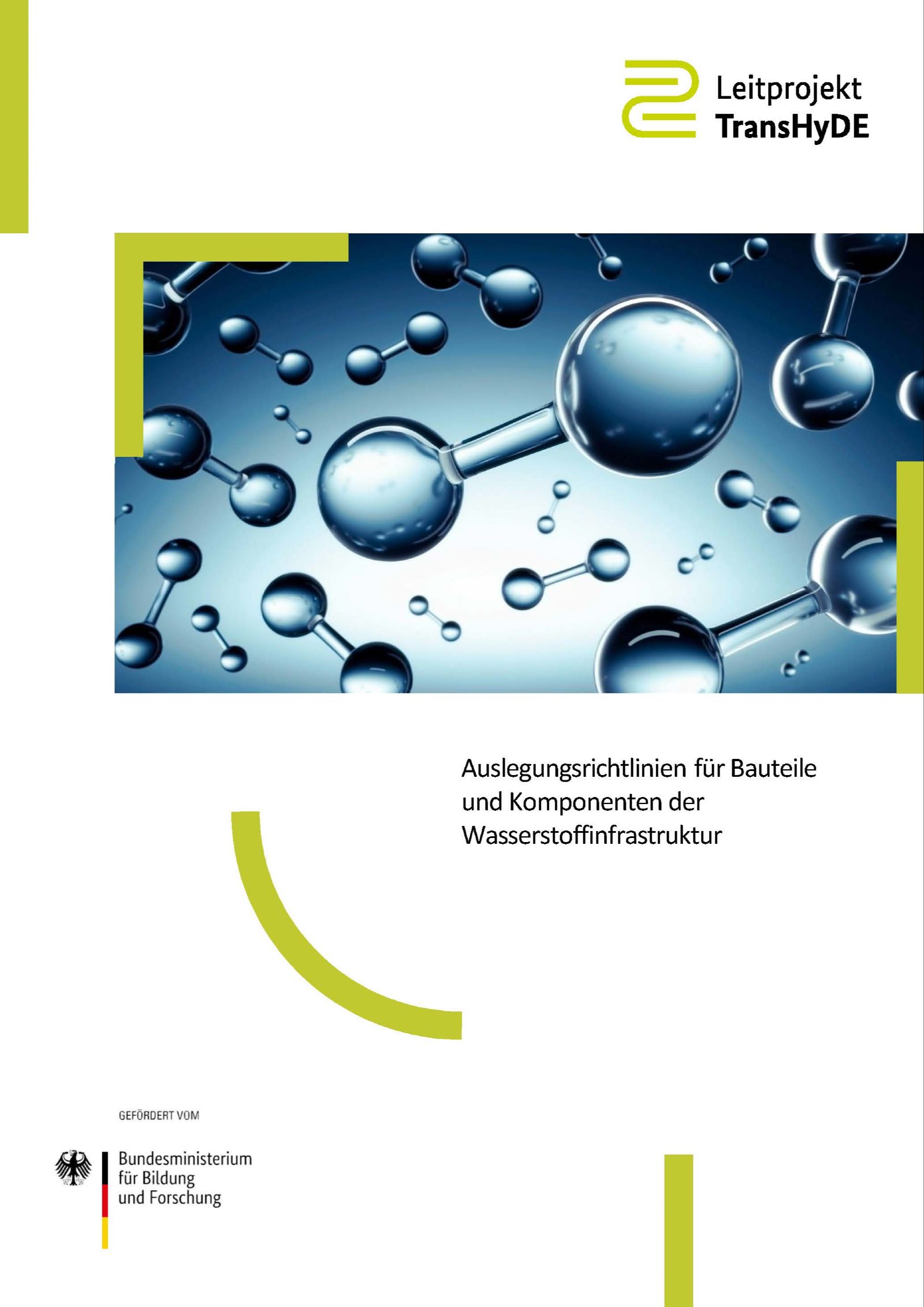
Auslegungsrichtlinien für Bauteile und Komponenten
Whitepaper zu Auslegungsrichtlinien für Bauteile und Komponenten der Wasserstoffinfrastruktur
Zum Papier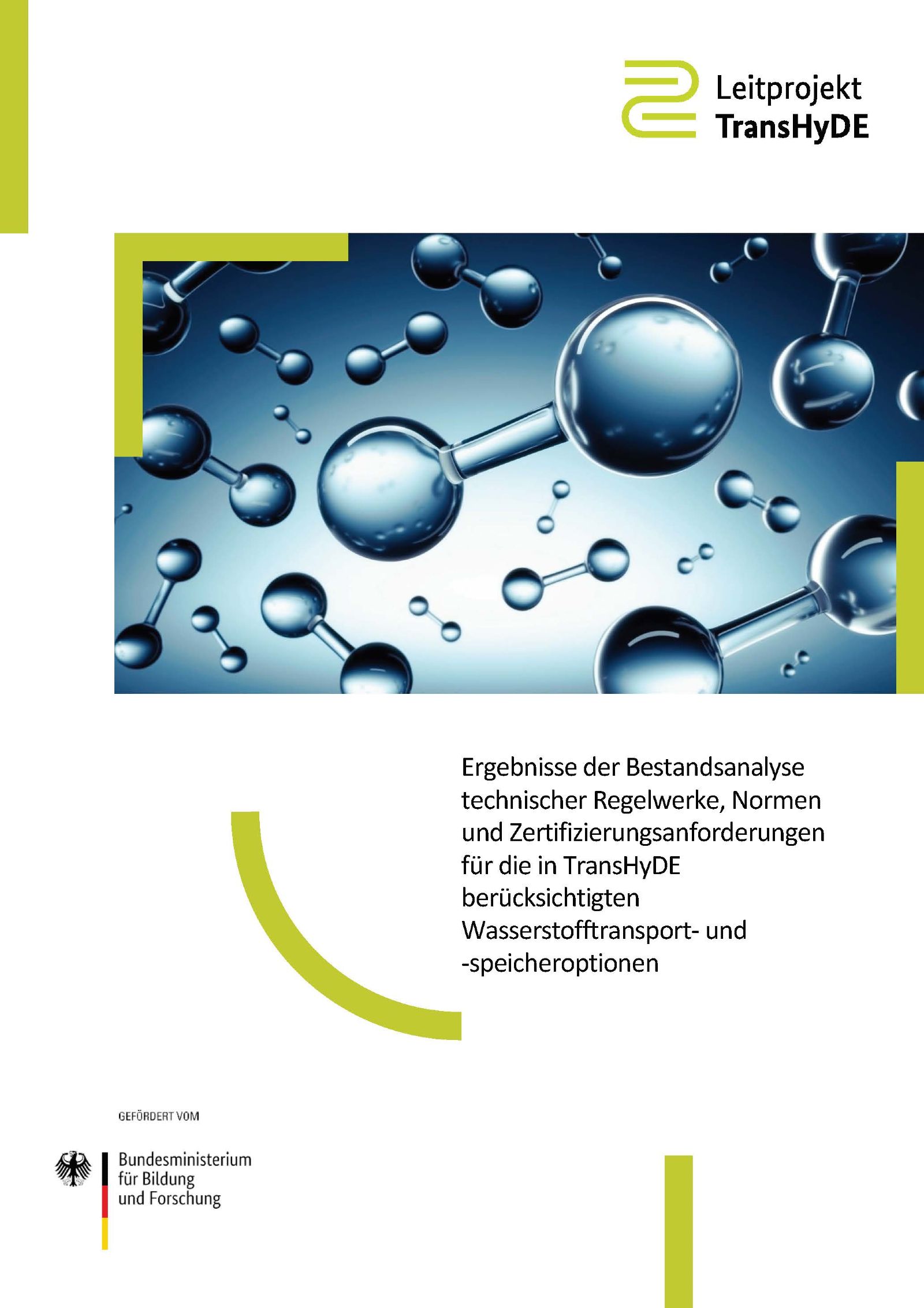
Transport- und speicheroptionen
Whitepaper zu den Ergebnissen der Bestandsanalyse technischer Regelwerke, Normen und Zertifizierungsanforderungen für die in TransHyDE berücksichtigten Wasserstofftransport- und -speicheroptionen
Zum Papier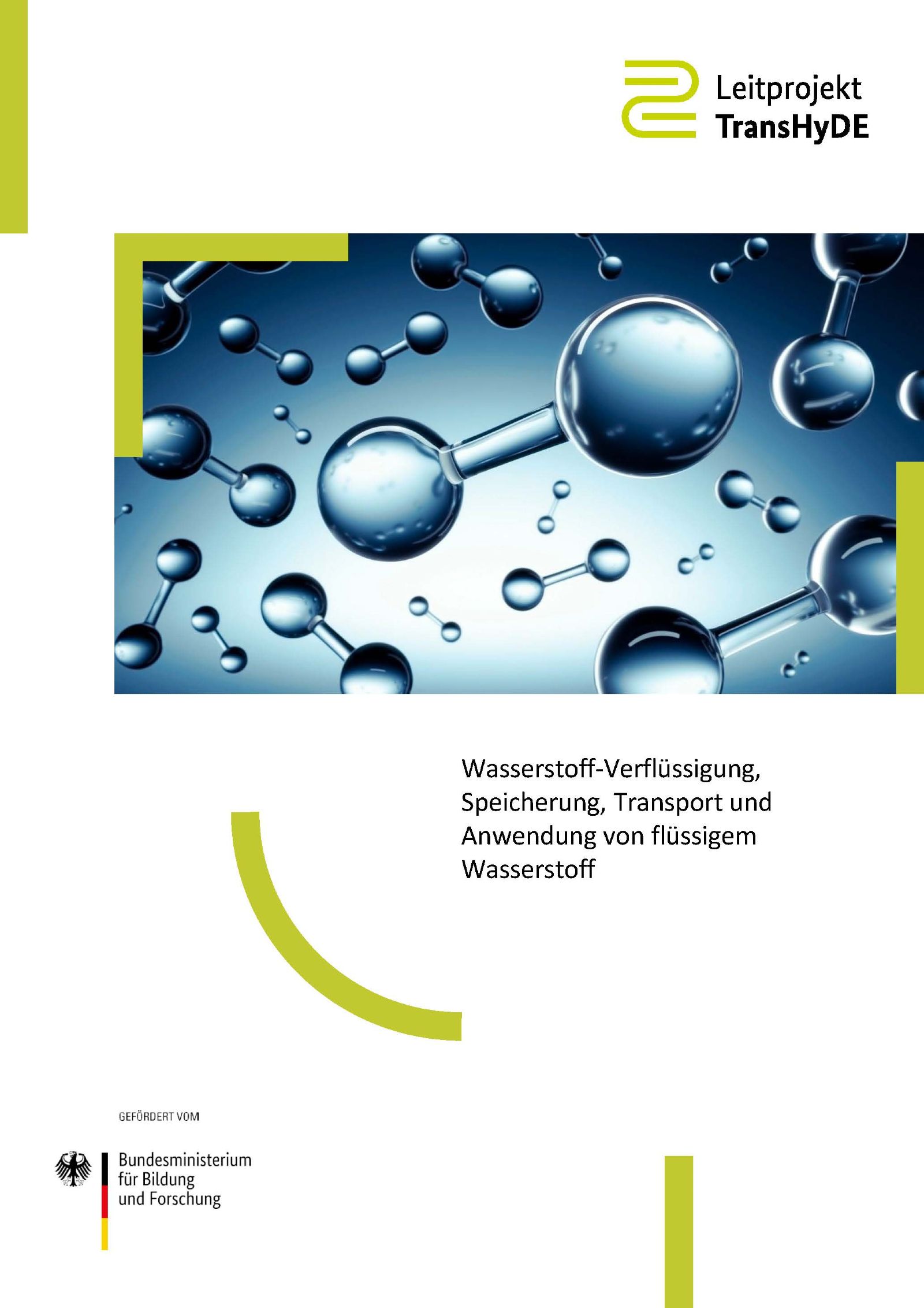
Flüssig-Wasserstoff
Whitepaper zu Wasserstoff-Verflüssigung, Speicherung, Transport und Anwendung von flüssigem Wasserstoff
Zum Papier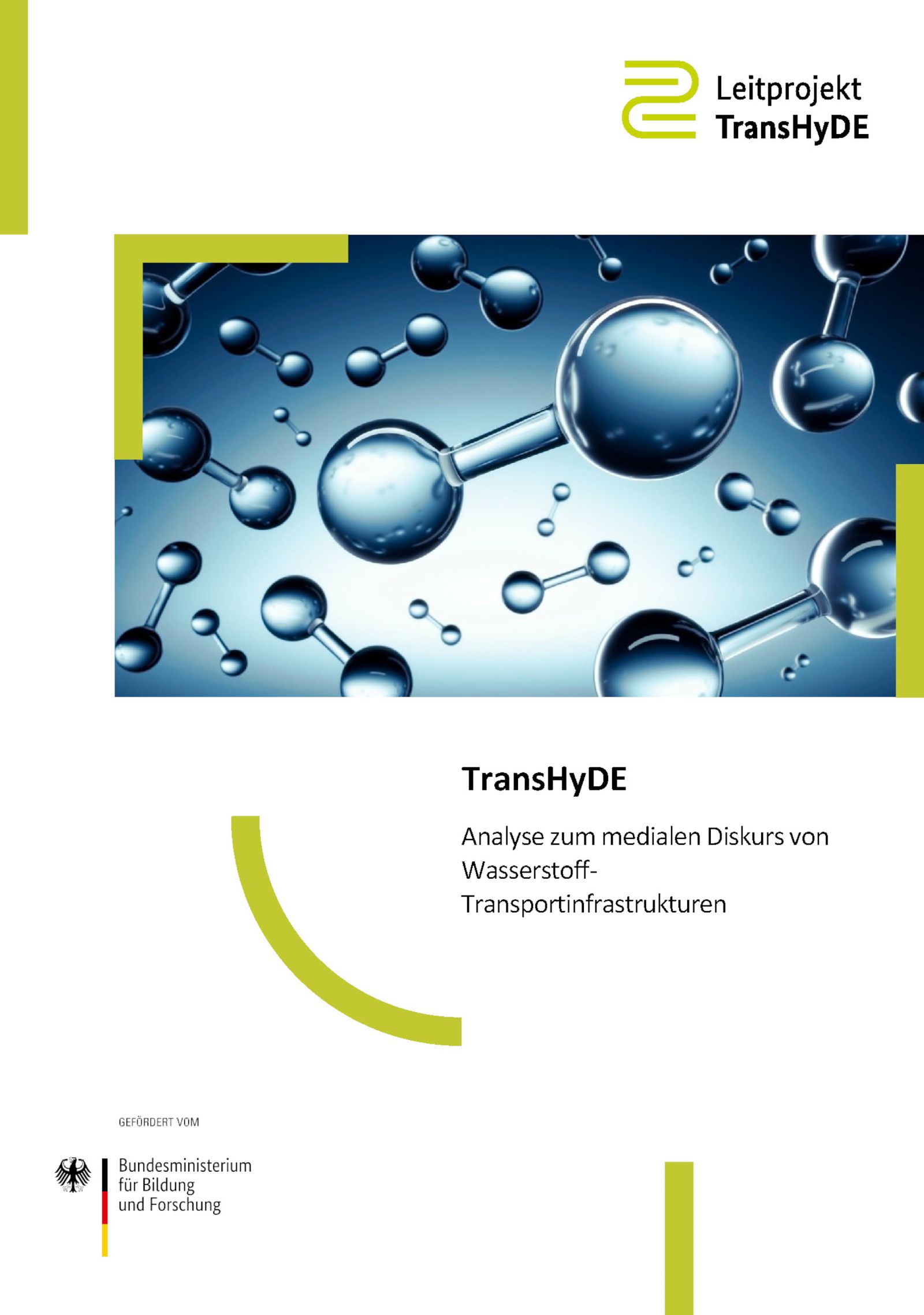
Transportinfrastrukturen
Whitepaper „Analyse zum medialen Diskurs von Wasserstoff-Transportinfrastrukturen“
Zum Papier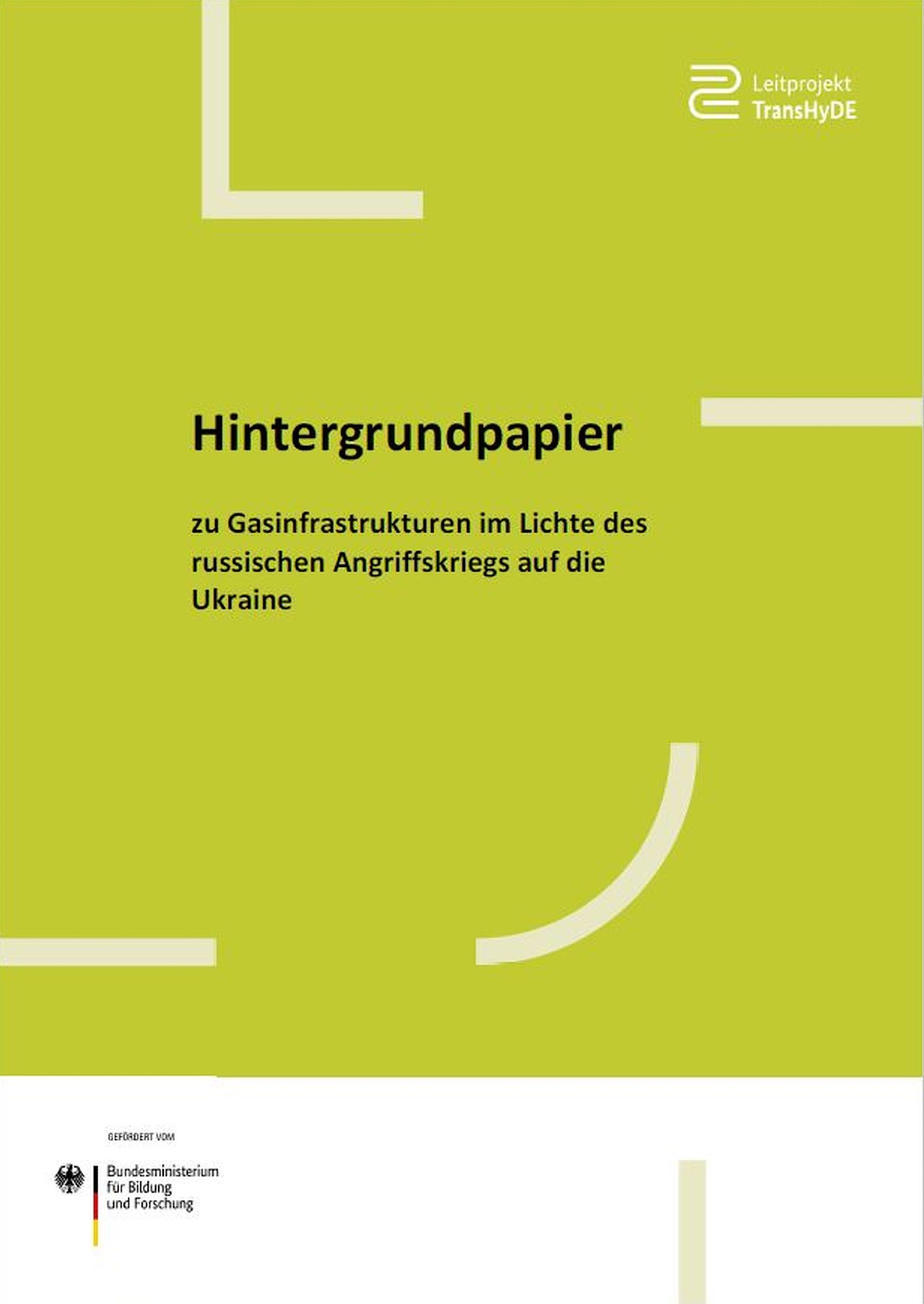
Positionspapier
Hintergrundpapier zu Gasinfrastrukturen im Lichte des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine
Zum Papier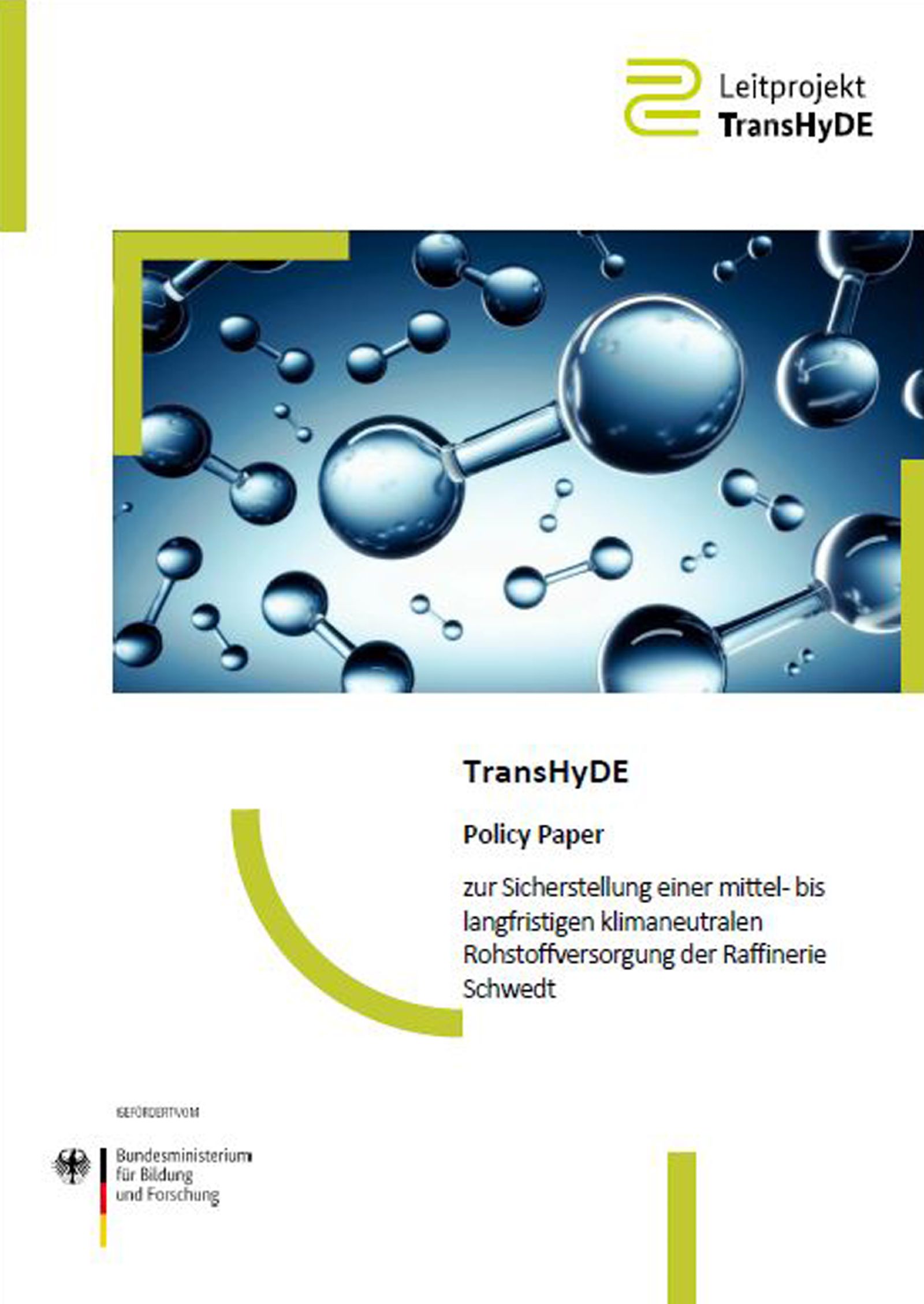
Policy Paper
Papier zur Sicherstellung einer mittel- bis langfristigen klimaneutralen Rohstoffversorgung der Raffinerie Schwedt
Zum Papier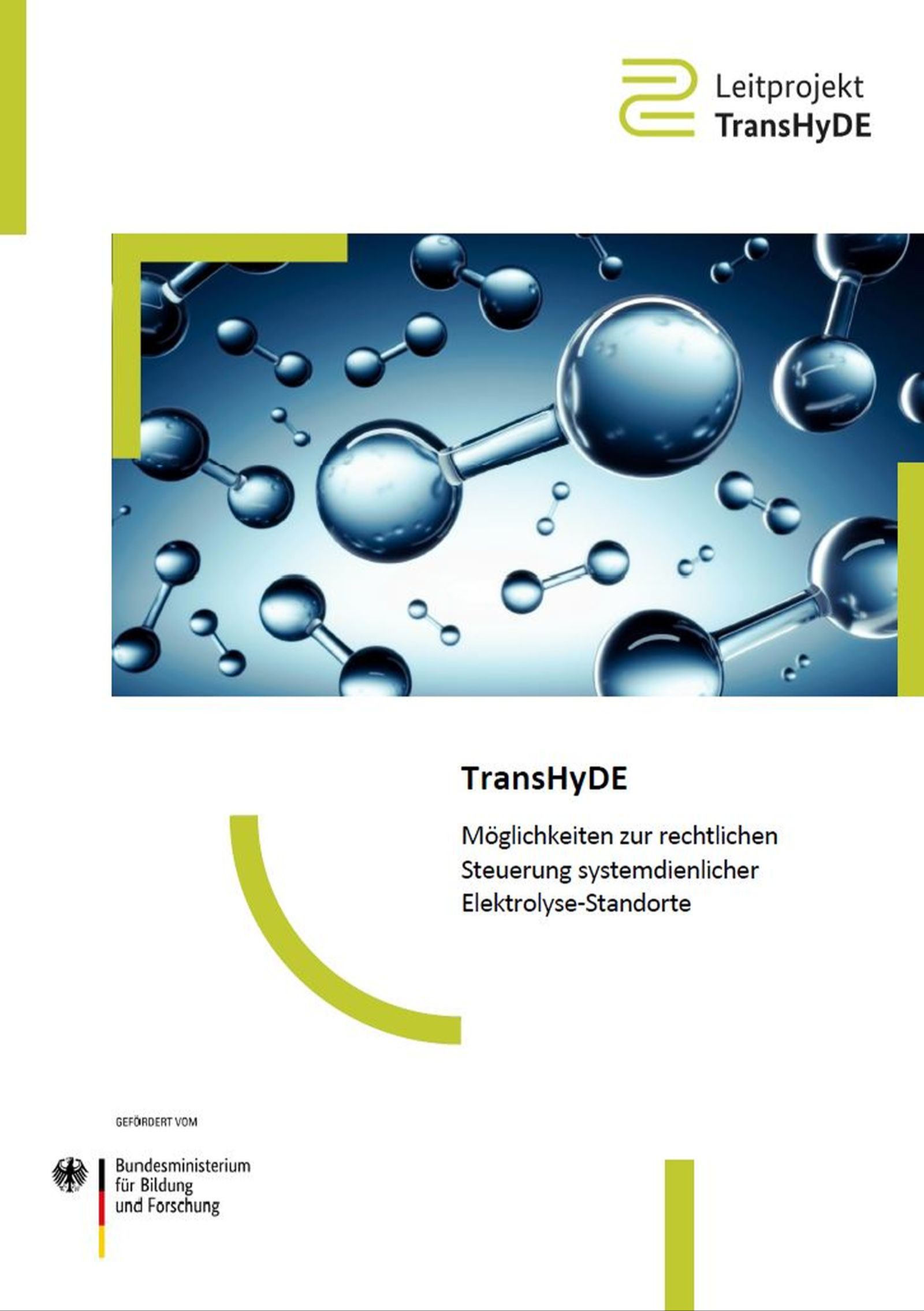
Kurzanalyse
Möglichkeiten zur rechtlichen Steuerung systemdienlicher Elektrolyse-Standorte
Zur Analyse